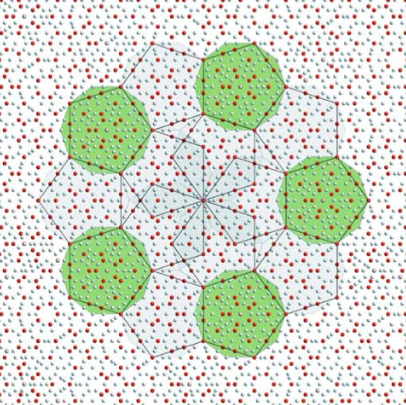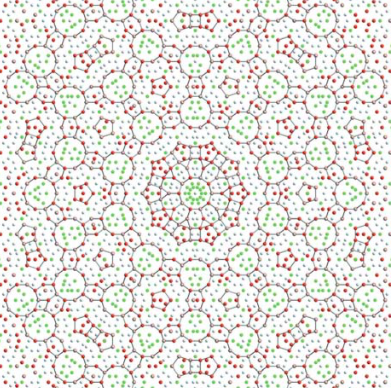Kinderkrankheit ist eigentlich ein unzeitgemässer, veralteter Begriff. Die Kinderkrankheiten heissen Kinderkrankheiten, weil sie so ansteckend und verbreitet waren, dass jedes Kind sie bei Kontakt mit den Erregern sofort bekam, und nicht, weil sie so harmlos sind oder sie nur Kinder bekommen können! Die Erwachsenen waren, falls sie es überlebt hatten, dann immun, eine Alternative zum Durchmachen der Krankheit, wie es sie heute dank Impfungen für viele Kinderkrankheiten gibt, gab es ja nicht. Auch heute gibt es nicht gegen alle Erreger hochansteckender Krankheiten Impfungen-aber es kommen hin und wieder neue hinzu. Sind diese denn auch wirklich empfehlenswert und risikoarm?
Die meisten ja-es ist eine gute Sache, wenn wir einigen Krankheitserregern die Opfer soweit entziehen können, dass sie praktisch aussterben. Besonders solchen, die lebensbedrohliche Auswirkungen haben oder bleibende Schäden verursachen können, und dazu gehören die meisten Kinderkrankheiten.
Aber der Nutzen von Impfungen muss deren Risiken überwiegen; damit sie sinnvoll sind. Dieses Verhältnis von Nutzen zu Risiken sollte man für jede Impfung abwägen.
Man kann den Gesundheitsbehörden und Ärzten in ihren Empfehlungen folgen, die normalerweise auf sorgfältigen Entscheiden beruhen. Gesundheitsbehörden haben jeweils die neueste wissenschaftliche Information- und sie prüfen diese auch. Man kann dennoch auch selbst etwas nachrecherchieren und sich informieren. Hier eine kleine Grundlage mit Basis-Infos zu den einzelnen Krankheiten und in der Schweiz empfohlenen Impfungen und Fakten dazu:
- DTPa-IPV/Hib: fünffache Impfung gegen Diphterie, Tetanus, Keuchhusten, Polio, Haemophilus influenzae Bakterium Typ b:
Diphterie-dank Impfung in unseren Breitengraden fast ausgerottet, in Russland oder Nordafrika zum Beispiel noch präsent. Eine Infektion führt in etwa zehn Prozent der Fälle zum Tod.
Tetanus/Starrkrampf-Bakterien kommen überall vor, z.B. in der Erde, im Strassenstaub, und können schon durch eine kleine, unbemerkte Verletzung in den Körper gelangen. Bei Ansteckung kann die Krankheit in 25 Prozent der Fälle tödlich enden.
Pertussis/Keuchhusten ist insbesondere für Säuglinge im ersten Lebenshalbjahr gefährlich, da sich der Keuchhusten bei ihnen in Atemstillständen äussern kann. Die Behandlung mit Antibiotika verläuft nicht immer erfolgreich. In einem von 1000 Fällen verläuft die Infektion tödlich.
Polio/Kinderlähmung: Das Virus ist in Europa praktisch ausgerottet (dank Impfung). Es kommt aber noch in einigen afrikanischen und asiatischen Ländern vor. Bei rund 1 Prozent der angesteckten Personen kommt es zu Lähmungen, und die Krankheit kann auch tödlich verlaufen. Es gibt keine Medikamente zur Behandlung.
Haemophilus-Bakterien liessen vor der Impfung jedes 500. infizierte Baby schwer erkranken und führten zu Hirnhaut- oder Kehldeckelentzündung. Letzteres zieht Erstickungsgefahr nach sich. Es gibt Antibiotika dagegen, die aber nicht in allen Fällen genügend wirksam sind.
Die DTPa-IPV Komponente dieser fünffach-Impfung enthält Aluminiumhydroxid. Die Impfung gibt es auch als sechsfache Impfung, zusätzlich mit Hepatitis B Komponente.
Häufig treten bei diesen Impfstoffen leichte Nebenwirkungen wie Fieber, lokale Reaktionen, Reizbarkeit auf. Ein Zusammenhang der Impfung mit Meningitis, Paralyse, Enzephalitis, Enzephalopathie, Neuropathie, Neuritis, Hypotension, Vaskulitis, Lichen Planus, Erythema, Arthritis, Muskelschwäche, Guillain-Barré Syndrom, Allergien und Thrombozytopenien konnte nicht bestätigt werden.
- MMR: Mumps Masern Röteln Dreifachimpfung:
Der Mumps-Virus kann Gehirnentzündung (Enzephalitis) sowie bei Jungs Unfruchtbarkeit verursachen.
Masern lösen bei jedem tausendsten Kind eine Gehirnentzündung aus. Von diesen schweren Fällen bleiben einige behindert, und zwanzig Prozent sterben. Als Komplikationen können auch Lungenentzündung, Mittelohrentzündung sowie Infektionen des Kehlkopfes und der Luftröhre auftreten.
Röteln sind für Schwangere bzw. ungeborene Babies sehr gefährlich.
Durch die MMR-Kombi-Impfung können in seltenen Fällen Fieberkrämpfe auftreten bzw. das Risiko dafür ist während einiger Tage erhöht. Selten heisst, dass weniger als ein Kind von tausend betroffen ist. Ein Zusammenhang der Impfung mit Hirn- und Hirnhautentzündungen ist nicht komplett auszuschliessen. Diese schweren Komlikationen treten aber impfstoffbedingt nur alle 3 Millionen Impfungen auf, d.h. viel seltener als dies durch die Ansteckung mit Masern passiert. Ähnliches gilt für die subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE), eine schwere Komplikation, die impfbedingt 1-mal auf eine Million Kinder auftreten kann, im Falle der Infektion mit Masern aber 6 bis 22-mal häufiger.
Einen Zusammenhang der MMR-Impfung mit Krankheiten wie Autismus, Asthma, Leukämie, Diabetes Typ I, Morbus Crohn, demyelinisierenden Erkrankungen, Heuschnupfen, Gehstörungen, anderen bakteriellen oder viralen Infekten gibt es hingegen nach neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht.
Die MMR-Impfung enthält weder Quecksilber (Thiomersal) noch Aluminium.
Zusätzlich möglich sind untenstehende Impfungen. Sie gehören nicht zu den empfohlenen Basis-Impfungen, und werden einem daher von Kinderarzt vielleicht nicht so dringend ans Herz gelegt. Man sollte aber für seine Kinder auch die Nutzen-Risiko-Überlegung für die folgenden Impfungen anstellen:
Pneumokokken sind bakterielle Krankheitserreger, von denen es (leider) mehrere gibt. Rund 23 Typen davon sind für Erkrankungen wie Hirnhautentzündungen, Blutvergiftungen, Lungen- und Mittelohrentzündungen verantwortlich. Die Impfung ist seit 2015 zugelassen und schützt gegen 13 der Bakterientypen mit 75 bis 90-prozentiger Wirksamkeit. Nach den Haemophilus-Bakterien sind Pneumokokken die zweithäufigste Ursache für schwere bakterielle Infektionen bei Kleinkindern.
Die Impfung löst bei 1-7 Prozent der Kinder Fieber aus, und kann unter Umsständen einen Fieberkrampf auslösen. Schwere Nebenwirkungen sind sehr selten (1-mal auf
100 000 bis 1 000 000 Impfungen), aber in dieser Häufigkeit kann ein Zusammenhang des Impfstoff mit Arthralgien, Arthritis, und einigen Nervenkrankheiten wie dem Guillain-Barré-Syndrom nicht völlig ausgeschlossen werden. Die Impfung enthält Aluminiumphosphat.
Für Kinder ab 2 Jahren und Erwachsene gibt es auch einen Impfstoff, der gegen alle 23 Bakterientypen aktiv ist.
Meningokokken sind ebenfalls Bakterien, die Hirnhautentzündungen und Blutvergiftungen auslösen können. Auch sie kommen in verschiedenen Gruppen vor -die Impfung schützt gegen die Typen C, zu 83 bis 98 Prozent. Meningokokken-Infektionen müssen im Spital mit Antibiotika behandelt werden, können sich innert Stunden stark verschlechtern und auch tödlich enden.
Nach der Impfung treten leichte Nebenwirkungen wie geringes Fieber, Reizbarkeit, Schläfrigkeit oder Appetitlosigkeit als auch örtliche Reaktionen wie Schwellung, Schmerzen und Rötung relativ häufig, bei 1-4 von 20 Kleinkindern auf. Das Fieberkrampf-Risiko ist auch bei dieser Impfung für einige Tage leicht erhöht. Ebenso sind vorübergehende Muskel- und Gelenkschmerzen recht häufig. Sehr selten kommen andere vorübergehende Nervenstörungen wie Ohnmachtanfälle vor. Die verfügbaren Impfstoffe enthalten Aluminiumverbindungen.
Hepatitis B ist nicht hochansteckend, nur über Blut und Geschlechtsverkehr. Daher eigentlich nur für Babys nötig, deren Eltern infiziert sind. Für Erwachsene, wenn sie in Gebiete reisen, in denen das Virus häufig ist. Das Virus bricht bei einer von zehn infizierten Personen aus und führt zu Lebererkrankungen.
ALLE Kinderkrankheiten können auch ungeimpfte oder nie erkrankte Erwachsene infizieren und sich über diese weiterverbreiten. Bei Erwachsenen verlaufen die Kinderkrankheiten sogar häufig schlimmer. Auch aus ganz egoistischen Gründen sollten Sie daher ihren Impfschutz bezüglich MMR, DT, und Polio/IPV überprüfen. Falls Sie mit Babys viel Zeit verbringen, sollten Sie sich gegen Keuchusten impfen lassen. Überlegen Sie sich auch, ob eine Impfung gegen Zeckenenzephalitis und Hepatitis B eventuell für Sie empfehlenswert ist.
In der Schweiz gibt es keine Impfpflicht, nur Empfehlungen. Bei der Entscheidung sollte man auch das Gemeinwohl im Auge behalten. Wenn man die Verbreitung einer hochansteckenden und gefährlichen Infektion in Kauf nimmt, trägt man auch dafür Verantwortung, nicht nur für das Erkrankungsrisiko von sich selbst oder der eigenen Familie. Menschen mit eingeschränktem Immunsystem, Schwangere und Stillende haben die Wahl für oder gegen eine Impfung meist nicht -sie sind daher darauf angewiesen, dass die Krankheiten sich gar nicht erst ausbreiten. Wenn alle, denen es möglich ist, sich impfen lassen, ist die ganze Gemeinschaft (z.B. ein ganzes Land) vor dieser Krankheit geschützt -und diese wird unter Umständen ausgerottet. Die Entscheidung für oder gegen Impfungen sollte daher keine rein individuelle sein.
Langweilig wird es dem Immunsystem durch Impfungen nicht, da genug Krankheitserreger übrigbleiben, die ständig neue geographische Gebiete erobern.. und es auch noch genug Kinderkrankheiten gibt, gegen die keine Impfung existiert. “Das Immunsystem trainieren“ kann/muss man z.B. noch mit Scharlach, Ringelröteln, Hand-Fuss-Mund-Krankheit, Dreitagefieber, …
Alumimiumverbindungen sind in einigen Impfstoffen enthalten. Sie führen bei ihrem Einsatz zu einer verstärkten Reaktion des Immunsystems. Die Mengen sind sehr klein. Aktuell sind in drei der für Kinder empfohlenen Impfungen je 0.125-0.82 mg Aluminium enthalten. Aktuell spricht die Nutzen-Risiko-Analyse für die Impfstoffe –trotz mimimem Metallgehalt. Aluminium ist kein
Schwer-, sondern ein Leichtmetall. Man findet es natürlicherweise in Mengen von 50 bis 150 mg im menschlichen Körper. Über die Nahrung aufgenommenes Aluminium wird über den Urin wieder ausgeschieden. Dasselbe passiert mit den Aluminiumverbindungen aus den Impfungen: sie werden grösstenteils wieder ausgeschieden, 1 oder 2 Prozent allerdings verbleiben im Körper; das ergibt eine Gesamtaufnahme an Aluminium durch Impfungen im Laufe eines Lebens von höchstens 0.5 mg. Lebenslang aufgenommen wird eine Menge von etwa 35 mg Aluminium- da erscheint der Anteil von 0.5 mg sehr gering.
Studien zeigen, dass kein Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen und Allergien besteht. Dennoch ist nicht absolut klar, ob
1. Aluminiumverbindungen in Impfstoffen wirklich unersetzbar sind und
2. wenn ja, ob sie wirklich harmlos sind: Ein möglicher Zusammenhang von Aluminium mit Alzheimer kann derzeit nicht restlos ausgeschlossen werden.
Thiomersal, eine Quecksilberverbindung, ist als Konservierungsstoff (noch) in einigen Impfstoffen enthalten. Aus Impfstoffen für Kinder unter 6 Jahren wurde Thiomersal allerdings bereits verbannt, und ein Zusammenhang mit Autismus ist wissenschaftlich widerlegt.
Pseuoinfoberichte wie sie unter www.impfentscheid.ch zu finden sind, führen ein zeitgleiches Auftreten von beliebigen Ereignissen als Beweis dafür an, dass es zwischen den Ereignissen einen Zusammenhang gibt. Das muss jedem einigermassen kritisch denkenden Menschen seltsam vorkommen. Denn so liessen sich ja unzählige Zusammenhänge herstellen und als bewiesen deklarieren. Zum Beispiel könnte man dann auch behaupten, dass Computer für Diabetes verantwortlich sind, weil es seit Erfindung des Computers eine Anstieg in Diabeteserkrankungen gab, oder Autos seien für Enzephalitis verantwortlich, weil es seit es Autos auf der Strasse gibt mehr Hirnentzündungen gibt. Solche Behauptungen lassen zudem keinen Raum für die sorgfältige Suche nach den tatsächlichen Auslösern für diese Krankheiten.
Infoquellen: zur Beurteilung von Medikamenten und medizinischen Massnahmen: Cochrane Collaboration, http://www.cochrane.org/CD004407/ARI_using-combined-vaccine-protection-children-against-measles-mumps-and-rubella 2. wissenschaftliche Publikationen über medizinische Studien: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/?term=vaccines+childhood 3. übersichtliche Basis-Infos zu den einzelnen Kinderkrankheiten und Impfstoffen: PharmaWiki, z.B. http://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=MMR-Impfung 4. für genaue Angaben zu Inhaltsstoffen der Impfungen, ihren Risiken und Häufigkeit von durch die Impfung ausgelösten Nebenwirkungen: http://www.compendium.ch, und dann die Fachinformation anklicken, enthält viel Fachchinesisch, ist aber einigermassen entzifferbar.z.B. https://compendium.ch/mpro/mnr/27674/html/de 5. Bei Infovac kann man nachschauen, welche Impfstoffe Aluminium enthalten. Zusätzlich kann man auf dieser Beratungsstelle, die mit wissenschaftlichen Belegen arbeitet, direkt Fragen stellen, die von Kinderärzten und Infektiologen innert 2 Tagen beantwortet werden: https://www.infovac.ch/de/impfstoffe/evidenz-oder-behauptungen